Yasemin Aydın
Die politische Strategie war durchschaubar. Als die AfD im Bundestag die Offenlegung der Vornamen von Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern forderte, ging es um mehr als um Statistik. Es ging darum, Bilder im Kopf zu erzeugen — die Vorstellung von Armut als importiertem Problem, von sozialer Unsicherheit als Folge kultureller Unterschiede. Diese Erzählung folgt einem bekannten Muster, das sich in vielen europäischen Demokratien beobachten lässt: Wo soziale Fragen komplex sind, wird Identität zum Ersatzthema gemacht.
Doch mit der Veröffentlichung der Daten zeigt sich ein anderes Bild. Die häufigsten Namen unter den Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern sind Andreas, Thomas, Michael. Namen, die alltäglich klingen, vertraut, die niemand in politische Kategorien zwängt. Das Ergebnis widerspricht der gewünschten Logik der Polarisierung. Und es öffnet den Raum für eine nüchterne Analyse — darüber, wie Gesellschaften funktionieren, wie Zugehörigkeit konstruiert wird und welche Rolle Sprache dabei spielt.
Was auf den ersten Blick wie ein kurzfristiger politischer Vorstoß wirkt, offenbart tiefere soziale Dynamiken. Sozialpsychologisch betrachtet, bedienen Parteien wie die AfD ein verbreitetes Bedürfnis nach Orientierung in unsicheren Zeiten. Wirtschaftlicher Druck, soziale Verwerfungen, die Angst vor Abstieg — all das erzeugt emotionale Unruhe. In solchen Situationen greifen Menschen instinktiv nach einfachen Erklärungen. Die Reduktion gesellschaftlicher Probleme auf Namen, Herkunft oder Kultur wirkt vermeintlich entlastend. Sie verspricht Klarheit, wo Komplexität überfordert.
Doch diese Erzählungen haben ihren Preis. Sie spalten Gesellschaften, statt sie zusammenzuführen. Sozialanthropologisch wissen wir: Gemeinschaft ist keine statische Größe. Sie entsteht durch alltägliche Aushandlungen — darüber, wer dazugehört, wer Rechte und Pflichten teilt, wer Solidarität erwarten darf. Wenn diese Prozesse durch kulturelle Stereotype ersetzt werden, verliert die Gesellschaft ihre Integrationskraft. Misstrauen wächst, Abgrenzung wird zur sozialen Norm.
Gerade deshalb lohnt ein genauer Blick auf die aktuellen Zahlen. Sie zeigen, dass Armut kein importiertes Problem ist. Sie zeigt sich quer durch die Gesellschaft, trifft Menschen unabhängig von ihrem Namen, ihrer Herkunft, ihrem Glauben. Wer Bürgergeld bezieht, kämpft oft nicht nur mit finanzieller Unsicherheit, sondern auch mit sozialem Stigma, mit mangelnden Bildungszugängen, mit prekären Arbeitsbedingungen. Diese Probleme sind strukturell — und sie lassen sich nicht mit Vornamen erklären.
Die Debatte selbst aber bleibt aufschlussreich. Sie zeigt, wie fragil gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, wenn politische Akteure gezielt an Vorurteile appellieren. Und sie offenbart, wie schnell Sprache zur Waffe werden kann. Die Forderung nach Namenslisten wirkt harmlos, fast technokratisch. Doch ihre soziale Funktion liegt tiefer: Sie soll Zugehörigkeit neu definieren, indem sie subtil Unterschiede markiert, wo eigentlich Gemeinsames zählt.
Dieser Mechanismus ist nicht neu. In vielen Ländern erleben wir derzeit ähnliche Muster: soziale Unsicherheit wird ethnisiert, wirtschaftliche Fragen werden in kulturelle Gegensatzpaare übersetzt. Die politische Hoffnung dahinter ist immer dieselbe — Kontrolle durch Vereinfachung, Machtgewinn durch Spaltung.
Doch die Realität ist widerständig. Die Vornamen, die nun bekannt wurden, lassen sich nicht instrumentalisieren. Sie erzählen keine Geschichte von “den Anderen”. Sie zeigen, dass soziale Unsicherheit mitten in der Gesellschaft entsteht, dort, wo politische Versäumnisse, wirtschaftliche Ungleichheit und fehlende Perspektiven aufeinandertreffen.
Wenn wir diese Debatte ernst nehmen wollen, müssen wir die Frage umdrehen: Nicht wer Armut trägt, sondern was wir als Gesellschaft tragen — an Verantwortung, an Solidarität, an der Bereitschaft, über einfache Erzählmuster hinauszudenken.
Denn am Ende entscheidet nicht der Vorname über Teilhabe oder Würde, sondern die Fähigkeit, gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Ohne Ausgrenzung, ohne Vereinfachung, ohne das alte Muster von “Wir” gegen “Die”.
In einer vielfältigen, offenen Gesellschaft liegt Stärke nicht im Trennen, sondern im Aushalten von Komplexität. Das erfordert mehr als Statistiken. Es erfordert politischen Mut, soziale Ehrlichkeit — und ein Bewusstsein dafür, dass die einfachen Antworten oft die gefährlichsten sind.



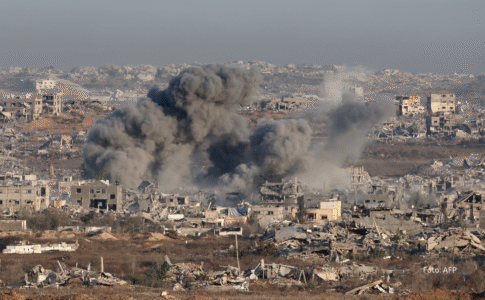


No comments