Yasemin Aydın
Der Besuch des Bundeskanzlers Friedrich Merz in Ankara im Oktober 2025 markierte keinen politischen Wendepunkt, sondern wurde zu einer aufschlussreichen Episode in der Psychologie internationaler Beziehungen. Er zeigte, wie Diplomatie – wenn sie keine Ergebnisse mehr erzielt – zu einem Theater der Symbole wird. Was sich zwischen Merz und Erdoğan abspielte, war weniger eine klassische politische Verhandlung als ein Spiegel, in dem Europa und die Türkei ihre eigenen ungelösten Fragen nach Identität, Anerkennung und Zugehörigkeit betrachteten.
Die Grammatik der Distanz
Der gesamte Besuch drehte sich, sinnbildlich gesprochen, um eine einzige Präposition. Merz sagte: „Wir sehen die Türkei eng an der Seite der Europäischen Union.“ Türkische Medien übersetzten diesen Satz als: „Deutschland möchte die Türkei in der EU sehen.“ Der Unterschied zwischen an der Seite und in scheint gering, doch in dieser Nuance steckt die emotionale und historische Distanz von sechs Jahrzehnten. In wenigen Worten verdichtet sich das zentrale Paradox der Beziehung: Nähe ohne Aufnahme, Partnerschaft ohne Gleichwertigkeit, Anerkennung ohne Akzeptanz.
Der Anthropologe Victor Turner bezeichnete solche Zustände als Liminalität – das Dazwischen-Sein. Die Türkei lebt seit mehr als einem halben Jahrhundert in dieser Zwischenzone: unverzichtbar für Europas Sicherheit, aber nie vollständig Teil seiner politischen oder moralischen Gemeinschaft. Was einst als Übergangsphase gedacht war, hat sich zu einem strukturellen Dauerzustand entwickelt – zu einem Warten ohne Ende.
Projektion und Verlangen nach Anerkennung
Aus psycho-politischer Sicht begegnen sich Europa und die Türkei in einem Spiegelspiel gegenseitiger Projektionen. Europa überträgt seine Ängste auf die Türkei – Ängste vor demografischem Wandel, kultureller Andersartigkeit und politischer Instabilität. Die Türkei projiziert ihr Bedürfnis nach Anerkennung auf Europa – den Wunsch, als modern, rational und europäisch gesehen zu werden. Beide Seiten definieren sich durch das Gegenüber.
Die Beziehung folgt damit dem, was Erik Erikson als Identitätsbestätigung bezeichnet: Das Selbst gewinnt Stabilität erst durch die Anerkennung eines bedeutenden Anderen. Für Europa ist die Türkei die Grenze, an der es seine liberale und säkulare Identität überprüft. Für die Türkei ist Europa die Bühne, auf der sie ihr modernes Selbst inszeniert. Die wiederholten Zurückweisungen oder Verschiebungen der Mitgliedschaft sind daher nicht nur politische Entscheidungen, sondern existenzielle Erfahrungen.
Die Semiotik der Authentizität
Das Bild, das viral ging – Merz, wie er seine Aktentasche selbst trägt – zeigt, wie Vertrauen in Symbolik übergeht. In Deutschland ist diese Szene alltäglich und unbeachtet. In der Türkei wurde sie zur Schlagzeile, gedeutet als Geste der Bescheidenheit oder als sorgfältig kalkulierte PR-Strategie. Dieser Unterschied offenbart mehr als kulturelle Eigenheiten: Er legt offen, wie unterschiedlich politische Authentizität in beiden Gesellschaften verstanden wird.
Wo Institutionen Vertrauen genießen, ist Authentizität selbstverständlich, und Symbole bleiben unsichtbar. Wo Vertrauen fehlt, muss Authentizität inszeniert werden, und Symbole werden überladen. Die Fixierung auf Gesten, Objekte und Choreografie ist deshalb kein oberflächliches Phänomen, sondern Ausdruck einer tieferliegenden soziologischen Wahrheit: Wenn Bürger das Vertrauen in Systeme verlieren, suchen sie Aufrichtigkeit in Zeichen. Die Aktentasche wurde zum Ersatz für Integrität – ein emotionales Symbol für Glaubwürdigkeit in einer Welt des Misstrauens.
Zwischen Mitgliedschaft und Partnerschaft
Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sprach Erdoğan vom „Ziel der Vollmitgliedschaft“, während Merz von „Partnerschaft“ und „Nähe“ sprach. Zwischen diesen Begriffen liegt die ganze Geschichte der Beziehung. Für die Europäische Union ist die Türkei ein funktionaler Akteur – entscheidend für Migration, Energie und Sicherheit. Für die Türkei hingegen ist Europa mehr als ein politischer Partner: Es ist ein symbolisches Zuhause, der imaginierte Endpunkt eines hundertjährigen Modernisierungsprojekts.
Dieses Missverhältnis schafft, was man als performative Diplomatie bezeichnen könnte – ein Ritual der Gleichheit innerhalb einer Struktur der Ungleichheit. Beide Seiten inszenieren gegenseitigen Respekt, während sie asymmetrische Machtverhältnisse aufrechterhalten. Jeder Händedruck wird zur Geste des Verbergens und Offenlegens zugleich.
Das Theater des Vertrauens
Vertrauen zeigte sich in den kleinen, symbolischen Details. Erdoğan empfing Merz in einem deutschen Maybach, geschmückt mit der deutschen Flagge und dem türkischen Präsidentenwappen. Ein deutscher Politiker fährt in Ankara in einem deutschen Auto, das türkische Größe symbolisiert – kein Zufall, sondern Choreografie. Wo Vertrauen dünn ist, müssen Gesten Gewicht tragen.
Solche Momente machen deutlich, dass Diplomatie längst zu einer Form von Dramaturgie geworden ist. Taschen, Autos, Körperhaltungen und Blickrichtungen übernehmen die emotionale Arbeit, die Institutionen nicht mehr leisten können. Jede Geste kompensiert das Fehlen von Vertrauen. Je schwächer das Fundament der Beziehung, desto stärker wird ihre Symbolik.
Europas Spiegelstadium
Das Zögern Europas gegenüber der Türkei verweist auf eine doppelte Krise – eine Identitätskrise Europas und eine Systemkrise der Türkei. Die Aufnahme der Türkei würde bedeuten, Europa als universelles politisches Projekt und nicht als kulturellen Klub zu begreifen. Der Ausschluss dagegen bestätigt, dass Europas Liberalismus weiterhin auf Grenzen beruht, die durch Geschichte, Religion und kulturelle Selbstbilder gezogen sind. Das „endlose Vielleicht“ ist daher mehr als diplomatische Vorsicht: Es ist ein psychologischer Selbstschutz, eine Möglichkeit, die eigene Ambivalenz nicht auflösen zu müssen.
Doch diese Ambivalenz hat eine bequeme Seite. Denn während Europa sein moralisches Selbstbild wahrt, liefert die innere Entwicklung der Türkei seit über einem Jahrzehnt eine willkommene Rechtfertigung, um die Tür geschlossen zu halten. In den letzten dreizehn Jahren hat sich die Türkei sichtbar von demokratischen, rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Standards entfernt. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ausgehöhlt, Medienpluralismus existiert nur noch fragmentarisch, und die Zivilgesellschaft steht unter massivem Druck. Die wirtschaftliche Krise verschärft diese autoritäre Dynamik, da politische Loyalität zunehmend zur Währung ökonomischen Überlebens geworden ist.
Für die Europäische Union bietet diese Entwicklung eine bequeme, ja fast moralisch entlastende Grundlage: Man kann sich auf die Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte berufen, um die eigene Distanz zu legitimieren. Die Türkei ist in dieser Perspektive nicht nur „noch nicht bereit“, sondern wird zum warnenden Beispiel für die Grenzen europäischer Erweiterung. Die Kritik ist dabei durchaus berechtigt – doch sie bleibt selektiv, weil sie Europa erlaubt, seine eigene normative Reinheit zu behaupten, ohne die geopolitischen und ökonomischen Interessen zu hinterfragen, die die Partnerschaft längst prägen.
Die türkische Seite wiederum wehrt sich gegen diese Diagnose. Statt die strukturellen Defizite anzuerkennen, flüchtet sich die politische Elite in die Erzählung, Europa „möge die Türkei nicht“. Dieses Narrativ der Zurückweisung erfüllt eine doppelte Funktion: Es überspielt das eigene Demokratiedefizit und dient zugleich als emotionaler Kitt nach innen. Die EU wird so zum Spiegel, in dem die Türkei sich als Opfer der europäischen Arroganz inszenieren kann – und umgekehrt als moralischer Maßstab, den sie ständig verfehlt.
Europa befindet sich, im übertragenen Sinne, in seinem eigenen Spiegelstadium: Es versucht, sein Bild als inklusive, wertegeleitete Gemeinschaft mit seinem faktischen Verhalten gegenüber Außenseitern zu vereinen. Die bloße Existenz der Türkei im europäischen Diskurs macht diesen Widerspruch sichtbar. Die EU definiert sich gern als postnationales Projekt, bleibt jedoch von zivilisatorischen Reflexen verfolgt, die sie überwunden zu haben glaubt.
So stehen sich zwei Spiegel gegenüber: Auf der einen Seite ein Europa, das seine Grenzen moralisch rechtfertigt, auf der anderen eine Türkei, die ihre Defizite politisch verdrängt. Zwischen beiden liegt ein Niemandsland der Selbsttäuschungen, in dem Realpolitik und psychologische Projektion ununterscheidbar werden. Das „endlose Vielleicht“ ist daher nicht nur Ausdruck diplomatischer Vorsicht, sondern das Symptom einer Beziehung, in der beide Seiten im Spiegelbild des Anderen ihr eigenes Unbehagen erkennen – und es lieber dort lassen.
Von der Geopolitik zur Psychopolitik
Der Besuch von Merz zeigte, wie sich Diplomatie von der Ebene der Geopolitik zur Psychopolitik verschoben hat. Die sichtbaren Verhandlungen – Rüstungsverträge, Migrationsabkommen, Energieprojekte – bilden nur die Oberfläche. Darunter liegt ein unsichtbares Ringen um Anerkennung, Würde und emotionale Balance.
Die rasche Verbreitung der Fehlübersetzung von „an der Seite“ zu „in“ war kein sprachlicher Zufall, sondern Ausdruck eines psychologischen Bedürfnisses. Sie klang gut, sie gab Hoffnung, sie stellte Würde wieder her. Diese Episode verdeutlicht, dass internationale Beziehungen heute zunehmend von Emotionen bestimmt werden – von der Suche nach Zugehörigkeit, nicht nur nach Einfluss.
Die Politik der Zugehörigkeit
Das „endlose Vielleicht“ der Europäischen Union gegenüber der Türkei ist kein diplomatisches Patt, sondern ein Symptom der Zivilisation selbst. Es zeigt ein Europa, das unsicher über die Reichweite seiner Werte ist, und eine Türkei, die zwischen Stolz und Sehnsucht gefangen bleibt. Beide Seiten verhandeln nicht nur Interessen, sondern Identitäten.
Jede Geste, jede Fehlübersetzung, jedes inszenierte Treffen offenbart dieselbe ungelöste Wahrheit: Nähe ist keine Aufnahme, Partnerschaft keine Zugehörigkeit, und Anerkennung bleibt die seltenste Währung.
Diese Beziehung besteht nicht, weil sie funktioniert, sondern weil sie spiegelt. Europa blickt auf die Türkei und erkennt seine Ängste. Die Türkei blickt zurück und sieht ihre Hoffnungen. Zwischen diesen beiden Blicken liegt Europas endloses Vielleicht – ein Zustand ständiger Verhandlung zwischen Notwendigkeit und Verleugnung, zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir zu sein hoffen.



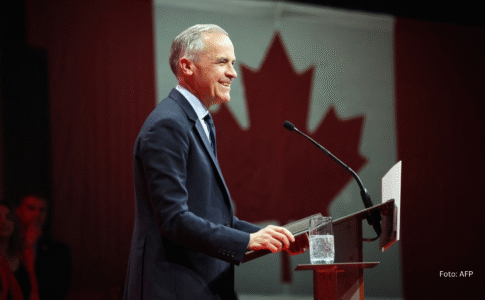


No comments